Niedrigwasser
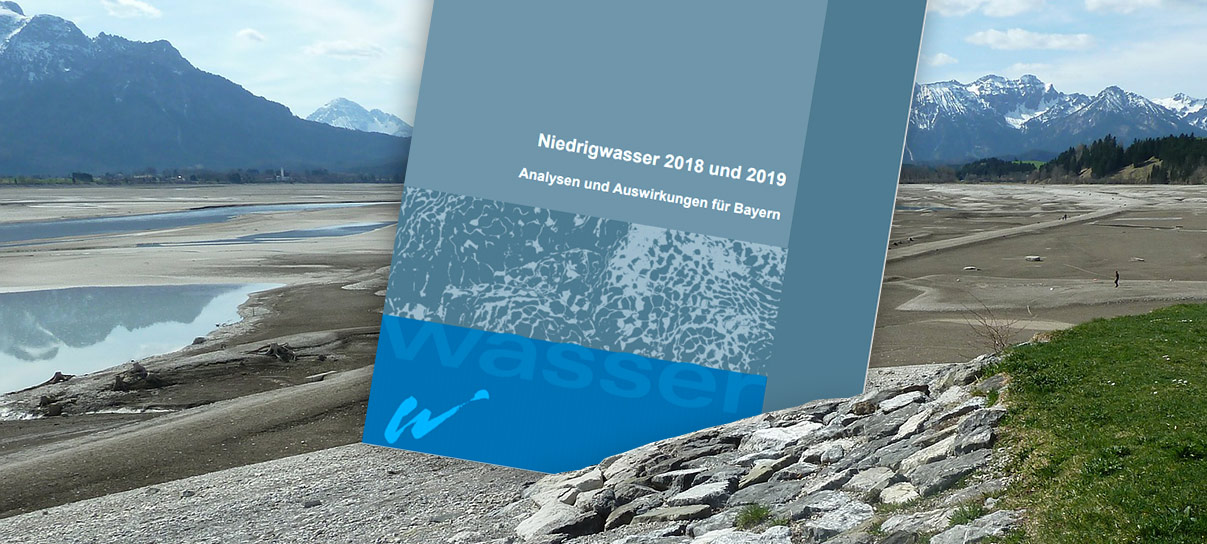
Flüsse und Seen prägen das Bild Bayerns. Im Jahr fallen durchschnittlich 940 mm Niederschlag (= 940 Liter pro Quadratmeter), der etwa zu 55 Prozent (%) über Pflanzen, Boden und Wasserflächen verdunstet und zu 45 % in den Flüssen abfließt und das Grundwasser speist. Die Niederschläge sind jedoch nicht gleichmäßig verteilt: In Nordbayern fallen stellenweise nur etwa 600 mm im Jahr, in Südbayern an der Donau 900 mm und im alpinen Bereich sogar über 2.000 mm.
Auch beim Grundwasser ist Südbayern begünstigt. Die ausgedehnten Schotterfelder im Untergrund können viel Grundwasser speichern – im Gegensatz zu den Festgesteinen Nordbayerns, welche nur wenige Hohlräume besitzen, in denen sich Wasser sammeln kann. Aber auch in Südbayern kann bei Extremwetterlagen Wasserknappheit auftreten. Um dem bereits heute in Nordbayern bestehenden Wassermangel entgegenzuwirken, wird Wasser in Tal sperren zwischengespeichert sowie Wasser aus dem Donaugebiet in das Maingebiet übergeleitet.
Der sich gegenwärtig abzeichnende Klimawandel wird sich auch zunehmend auf die Niederschlagsverteilung und -mengen auswirken. Hochwasser werden sich verschärfen, aber auch Trockenperioden mit niedrigen Wasserständen werden sich häufen.
Niedrigwasser-Informationsdienst
Bereits seit über 100 Jahren gibt es in Bayern einen Hochwassernachrichtendienst (www.hnd.bayern.de). Er hat sich bei der Warnung vor Hochwasser und dem rechtzeitigen Einleiten von Schutz maßnahmen bewährt. Nach diesem Vorbild ist auch der Niedrigwasser-Informationsdienst (NID) angelegt. Mit seinen Messdaten und Lageberichten bietet er bei Niedrigwasser die Grundlage für frühzeitige Reaktionen der Entscheidungsträger insbesondere der Wasserwirtschaft.
Auch die Öffentlichkeit kann sich jederzeit über die aktuelle Situation und die weitere Entwicklung informieren.
Das Grundgerüst für die Beobachtung
von Niedrigwasser sind überwiegend bereits bestehende, automatische Messnetze: Die 550 Pegel zur Messung der Wasserstände und Abflüsse in den Flüssen
sowie die 320 Niederschlags-Messstationen liefern eine gute Datengrundlage
nicht nur bei Hochwasser, sondern auch bei Niedrigwasser. Weitere Daten
stammen aus den Messnetzen für die
Wasserqualität in Flüssen und Seen. Für
die Bewertung der Grundwasserverhält
nisse werden Grundwasserstände und
Quellschüttungen ausgewertet.
Um bei Niedrigwasser Wasserstände
und Abflüsse vorhersagen zu können,
werden die Vorhersagemodelle des Hochwassernachrichtendienstes weiterentwickelt, so dass sie auch
die Veränderungen im Boden- und
Grundwasser sowie die Verluste durch
Verdunstung berücksichtigen.
Niedrigwasserbericht für 2018 und 2019
Für die beiden Niedrigwasserjahre 2018 und 2019 hat das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) die Auswirkungen auf die Wasserstände in Fließgewässern, Seen, Talsperren und Quellschüttungen analysiert. Auch die Entwicklung von Bodenwassergehalten und Grundwasserständen werden in dem Monitoring-Bericht dokumentiert.
Der Bericht ist im Publikationsshop der Staatsregierung unter https://www.bestellen.bayern.de/lfu_was_00198 abrufbar.

